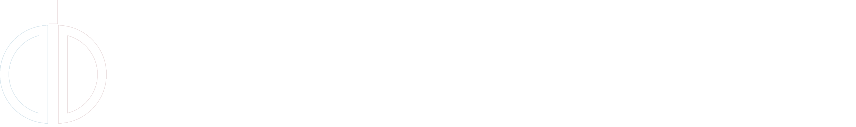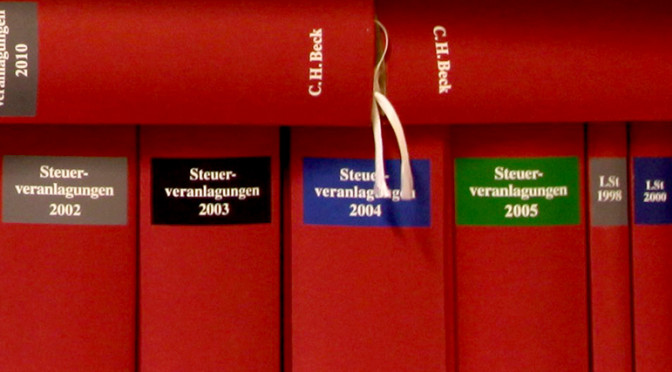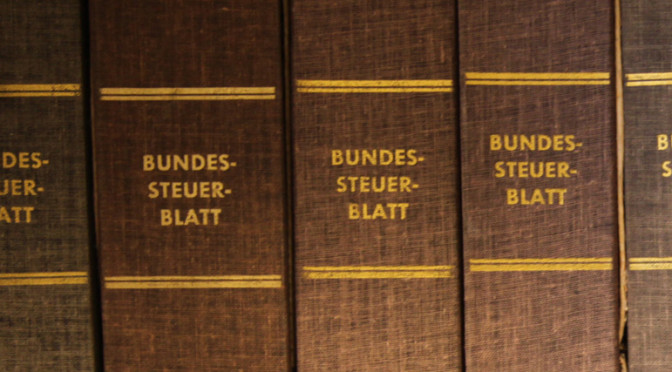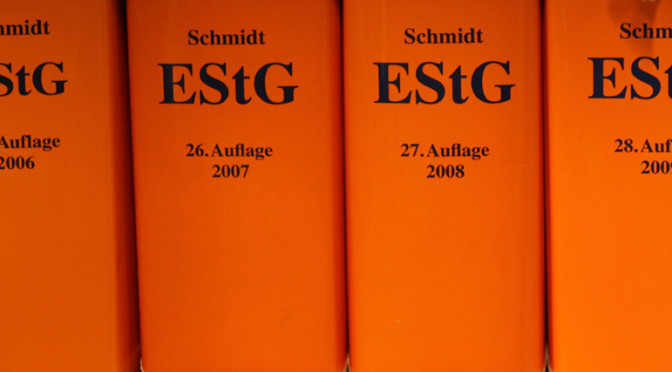Viele private Anbieter vergessen die steuerliche Relevanz von Mieteinnahmen aus AirBnB etc.
Im Regelfall handelt es sich dabei um Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gemäß § 21 Abs. 1 EStG, welche im Rahmen der eigenen Einkommensteuererklärung selbstverständlich auch anzugeben sind. Ob Sie darauf letztendlich tatsächlich Steuern zahlen müssen, sei einmal dahingestellt, da dies wiederum von unterschiedlichen Faktoren abhängt. So ist z.B. nur der durch die Vermietung erzielte Gewinn – vorbehaltlich der geltenden Grundfreibeträge – zu versteuern, d.h. Sie können Ausgaben wie Handwerkerleistungen im Zusammenhang mit der Untervermietung, die eigene anteilige Miete o.ä. von den Einnahmen zunächst einmal in Abzug bringen.
Die Aufteilung der Kosten in private Kosten und Werbungskosten im Zusammenhang mit der Vermietung und Verpachtung ist wegen der räumlichen Verflechtung selbstgenutzter und vermieteter Räume allerdings nicht ganz unproblematisch. So hat der BFH mit Urteil vom 22.01.2013 (Az. IX R 19/11) bei längerfristiger Untervermietung eine Aufteilung anhand der Anzahl der Haushaltsmitglieder inklusive der Übernachtungsgäste statt nach Fläche festgelegt. Bei kurzfristiger Vermietung ist die Aufteilung noch nicht abschließend geklärt. Sinnvoll wäre wohl eine Aufteilung nach zeitlichen Gesichtspunkten in Verbindung mit der Anzahl der Haushaltsmitglieder inklusive der Übernachtungsgäste.
Es existiert im Übrigen eine – wenn auch geringe – Freigrenze von EUR 520,00 jährlich für Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum oder für Mieter, die nur einen Teil ihrer Wohnung untervermieten (R 21.2 Abs. 1 EStR 2008).
Sollten sich aus der Vermietung gar Verluste ergeben, müsste wegen der möglichen Verrechenbarkeit mit anderen positiven Einkünften Vorsorge für den Nachweis der Überschusserzielungsabsicht gegenüber dem Finanzamt getroffen werden.
Grundsätzlich unterliegen die Einnahmen aus der Vermietung über AirBnB & Co. zudem auch der Umsatzsteuerpflicht. Gemäß der Kleinunternehmerregelung des § 19 Abs. 1 UStG wird Umsatzsteuer jedoch erst bei Überschreiten der Umsatzgrenzen von EUR 17.500 im Vorjahr und voraussichtlich EUR 50.000 im laufenden Jahr erhoben. Unbedingt zu beachten ist dabei jedoch, dass diese Grenzen sich nicht nur auf die Vermietung über AirBnB & Co. beziehen, sondern auf die gesamte unternehmerische Betätigung des Vermieters. Hat dieser daneben also noch weitere der Umsatzsteuer unterliegende Einnahmen – auch aus anderen Einkunftsarten –, sind diese einzubeziehen.
Sollten Sie die Vermietung in ganz „großem Stil“ betreiben, insbesondere Sonderleistungen wie ein Frühstücksangebot, die Bereithaltung von Personal, etwa eines Zimmerservices, etc. anbieten oder sollten Sie aufgrund des Umfangs eine unternehmerische Organisation benötigen, müsste darüber hinaus über eine etwaige Gewerbesteuerpflicht (Freibetrag hier: EUR 24.500) nachgedacht werden. Dies sollte aber zumindest bei der gelegentlichen Vermietung der selbstbewohnten Wohnung oder nur einzelner Räume dieser Wohnung über AirBnB, Wimdu usw. kaum der Fall sein.
Unter bestimmten Voraussetzungen, die hier jedoch nicht näher erläutert werden sollen, wären außerdem die Regelungen zur sogenannten Bauabzugsteuer zu beachten. Auch eine Rentenversicherungspflicht für die Einnahmen aus der Vermietung könnte theoretisch eintreten, nämlich dann, wenn die Betätigung als arbeitnehmerähnliche Selbständigkeit angesehen wird.